 „They pit the lifers against the new boy and the young against the old. The black against the white. Everything they do is to keep us in our place.“
„They pit the lifers against the new boy and the young against the old. The black against the white. Everything they do is to keep us in our place.“
Der Satz, gesprochen als prophetischer Voice-over in einem zunächst doch sehr im (damaligen) Hier und Jetzt verorteten Film ganz zu Beginn des Films, wird am Ende, wenn sich das Drama des Films in einem Standbild von nahezu antiker Ikonizität verdichtet, noch einmal wiederholt. Man erinnert sich schon Sekundenbruchteile, bevor die sonore Stimme erklingt, an die Worte vom Anfang und weiß sofort, dass sie nun noch einmal gesprochen werden – und man versteht dann auch, dass es sich nicht um einen Standard aus dem Phrasenbuch sozialistischer Proletarierverherrlichung und Kapitalismuskritik handelt, sondern um eine sehr konkrete Beobachtung, eine, die Schrader aus der tristgrauen Realität des Arbeitertums mit beinahe chirurgischer Präzision herausschält.
Zeke (Richard Pryor), Jerry (Harvey Keitel) und Smokey (Yaphet Kotto) sind Kumpels und außerdem Kollegen: Gemeinsam arbeiten sie in einer Automobilfabrik in Detroit. Sie werden beschissen bezahlt, die Schulden drücken und die einzige bescheidene Freude sind das Feierabendbier, die Parties mit Nutten und Koks, die Smokey immer mal schmeißt, und die Familienabende beim Bowling. Von der Gewerkschaft, die behauptet, ihre Interessen zu vertreten, werden die Arbeiter immer wieder mit leeren Versprechungen hingehalten oder verarscht. Als die Verzweiflung kaum noch auszuhalten ist, kommt Zeke eine Idee: Der Safe der Gewerkschaft wird lediglich von einem alten Zausel bewacht und beinhaltet bestimmt ein Vermögen. Also werden die drei zu Einbrechern: Und erbeuten dabei ein Geschäftsbuch, das Auskunft über die dubiosen Geldgeschäfte der Gewerkschaft gibt und deshalb von höchster Brisanz ist. Die Idee, damit Geld zu machen, ist verlockend, doch Zeke hat eigene Pläne …
Paul Schraders Regiedebüt ist eine bittere Anklage eines ausbeuterischen Systems, das auch deshalb floriert, weil es seine schwächsten Glieder gegeneinander ausspielt: die oben zitierte These. Zeke, Smokey und Jerry haben ein Mittel in der Hand, das Spiel zu ihren Gunsten zu beeinflussen, aber egoistische Motive obsiegen am Ende. Zeke – gleichzeitig der größte Träumer, aber auch der größte Realist der drei – ahnt, dass aus dem großen Putsch nichts werden wird, also geht er einen Handel ein, bei dem er wenigstens etwas abbekommt, natürlich auf Kosten seiner Freunde, die ihres Lebens danach nicht mehr sicher sein können. Die Verwandlung Zekes vom clownesken Verlierer in einen berechnenden, über Leichen gehenden Egoisten ist schockierend: Es ist, als hätten die Körperfresser von ihm Besitz ergriffen und seine Seele verschlungen. Man muss ihn für seinen grausamen Verrat verachten, aber eigentlich ist auch er ein Opfer. Das System hat ihm Gewalt angetan: keine körperliche, aber es hat ihm all seiner Prinzipien und Werte beraubt.
BLUE COLLAR ist ein bitterer Film, aber er lässt sich von der wenig erbaulichen Realität lange Zeit nicht unterkriegen, genau wie seine Protagonisten. Die Arbeit mag hart und dreckig sein, die Existenzängste groß, die Aussichten beschissen: Wenn die drei Freunde zusammen sind und ihre Bierchen zischen, sind die Sorgen zumindest für kurze Zeit vergessen. Bis ungefähr zur Hälfte ist BLUE COLLAR eine lupenreine Komödie, die vom Zusammenhalt der Arbeiter getragen wird. Dann, nach dem Einbruch, markiert eine Reihe von Auslassungen den Bruch. Was den Gesinnungswandel Zekes auslöst, lässt Schrader im Dunkeln, er konfrontiert den Zuschauer stattdessen mit harten Fakten, die aufgrund des Verzichts einer Herleitung umso schwerer treffen. Der Humor verflüchtigt sich und macht Platz für Paranoia und Todesangst. Jerry muss nach einem Mordanschlag Hilfe beim FBI suchen und seine Wurzeln kappen. Er fühlt sich nicht wohl im Schutz der Beamten, die in ihm auch nur einen „Fall“ sehen, und seine ehemaligen Freunde beäugen ihn wie einen Aussätzigen. Das ist aber noch nichts gegen die Konfrontation mit Zeke: Aus den Freunden sind Todfeinde geworden, die sich gegenseitig die Schädel einschlagen würden, wenn man sie ließe.
Schrader hat mit BLUE COLLAR einen meisterlichen Film hingelegt, und mit seinen drei Hauptdarstellern einen absoluten Volltreffer gelandet. Yaphet Kotto hat mich als cooler Smokey nach seiner Leistung in REPORT TO THE COMMISSIONER zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit begeistert. Er ist so etwas wie der Anführer des Trios, der große Bruder, der beschützend seine starke Hand über sie hält, bis es ihn kalt erwischt. Harvey Keitels Jerry ist eher unauffällig, ein zurückhaltender Typ, der aufbrausend wird, wenn man etwas gegen seine Gewerkschaft sagt: Eigentlich will er nur seine Ruhe haben, insofern ist er genau der Mann, denn sich die Mächtigen wünschen. Der Besetzungscoups schlechthin ist Stand-up-Legende Richard Pryor als Zeke, der sowohl den bemitleidenswerten spindeldürren Tropf überzeugend verkörpern kann wie auch den Morgenluft witternden Opportunisten. Pryors act umfasste immer eine geradezu schmerzhafte ehrliche Selbstanklage: Er war ein Getriebener und wusste ganz genau um seine Schwächen, die er immer wieder zur Zielscheibe seiner Gags machte. Seine Stand-up-Routinen waren eine Art der Selbstreinigung, Therapiestunden, das Publikum die Anvertrauten, denen er alles sagen konnte. In BLUE COLLAR scheint er den Ausbruch aus seinem Seelengefängnis zu proben: Wie wäre es, einmal ein anderer zu sein, der Typ, der auf alles scheißt und sich einfach nimmt, was er will? Die Verwandlung ist total, und am Ende, wenn sich sein immer etwas suchender, unsicherer Blick zu einer hasserfüllten Maske verzerrt, erkennt man ihn kaum noch wieder. Pryor blieb zum Glück Pryor, auch wenn er an diese Glanzleistung in Ermangelung wirklich ernsthafter Filmangebote nicht mehr anknüpfen konnte. Was aus Zeke geworden ist, will man lieber nicht wissen.
 Burt Reynolds ist in der vergangenen Woche verstorben. Er war einer der Superstars der Siebzigerjahre, bis in die Achtziger hinein wurden Starvehikel um ihn gestrickt, bis seine Masche und sein Schnäuz nicht mehr zeitgemäß waren und andere kernige Typen und ein anderer Typ Mann ihn ablösten. Und wie viele männliche Stars, die einen nicht unerheblichen Teil ihrer Popularität ihrer Attraktivität und Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht verdanken, fiel er mit zunehmendem Alter bei Publikum und Kritik in Ungnade. Burt Reynolds musste erst sterben, damit man sich wieder daran erinnerte, dass er nicht nur der gnadenlos selbstbewusste und geckenhaft lachende, unverschämt gut aussehende Typ mit dem Pornoschnurrbart war, sondern tatsächlich ein Schauspieler, der über eine unleugbare Leinwandpräsenz verfügte.
Burt Reynolds ist in der vergangenen Woche verstorben. Er war einer der Superstars der Siebzigerjahre, bis in die Achtziger hinein wurden Starvehikel um ihn gestrickt, bis seine Masche und sein Schnäuz nicht mehr zeitgemäß waren und andere kernige Typen und ein anderer Typ Mann ihn ablösten. Und wie viele männliche Stars, die einen nicht unerheblichen Teil ihrer Popularität ihrer Attraktivität und Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht verdanken, fiel er mit zunehmendem Alter bei Publikum und Kritik in Ungnade. Burt Reynolds musste erst sterben, damit man sich wieder daran erinnerte, dass er nicht nur der gnadenlos selbstbewusste und geckenhaft lachende, unverschämt gut aussehende Typ mit dem Pornoschnurrbart war, sondern tatsächlich ein Schauspieler, der über eine unleugbare Leinwandpräsenz verfügte.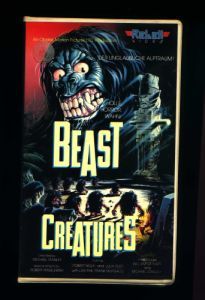 Vor 20 Jahren versüßte mir dieser in der heimischen Videothek abgegriffene Hobel aus der untersten Schublade manch Dosenbier-getränkte Stunde. Es handelt sich um einen dieser Filme, die ein halbambitionierter Hobbyregisseur wahrscheinlich zusammen mit seinen Kumpels in den Sommerferien im heimischen Forst abdrehte, die dann aber nicht ausschließlich zur eigenen Belustigung auf Privatvorführungen zum Einsatz kamen, sondern auf rätselhaften Wegen tatsächlich einen internationalen Verleih fanden und so arme Seelen rund um den Erdball erreichten. Irgendwie schön.
Vor 20 Jahren versüßte mir dieser in der heimischen Videothek abgegriffene Hobel aus der untersten Schublade manch Dosenbier-getränkte Stunde. Es handelt sich um einen dieser Filme, die ein halbambitionierter Hobbyregisseur wahrscheinlich zusammen mit seinen Kumpels in den Sommerferien im heimischen Forst abdrehte, die dann aber nicht ausschließlich zur eigenen Belustigung auf Privatvorführungen zum Einsatz kamen, sondern auf rätselhaften Wegen tatsächlich einen internationalen Verleih fanden und so arme Seelen rund um den Erdball erreichten. Irgendwie schön. Die Erblinie des italienischen Giallo der Siebzigerjahre führt vom Gothic Horror über den psychologischen Thriller über die Trivialisierung beider im deutschen „Gruselkrimi“ und der Pulp-Literatur. In Miraglias LA DAMA UCCIDE SETTE VOLTE wird das besonders deutlich: Die Geschichte um einen jahrhundertealten Fluch, der die Schwestern der Familie Wildenbruck in eine mörderische Intrige stürzt, sucht sie auch in der Gegenwart heim, in der die schöne Kitty (Barbara Bouchet) in den Glauben versetzt wird, das neuester Opfer ihrer toten Schwester Eveline, der titelgebenden „roten Königin“ zu sein. Natürlich hat die Mordserie, die im Zentrum des Filmes steht, höchst weltliche Gründe: Wie in vielen Edgar-Wallace-Filmen, die eine wichtige Inspiration für den Giallo waren, geht es um eine Erbschaft und der Fluch, den man offiziell als lächerliche Legende abtut, insgeheim aber doch fürchtet, ist nur eine willkommene Tarnung für die wahren Motive des Täters. Darunter schwelen ungelöste Geschwisterkonflikte, sexuelle Perversionen und bizarre Neurosen.
Die Erblinie des italienischen Giallo der Siebzigerjahre führt vom Gothic Horror über den psychologischen Thriller über die Trivialisierung beider im deutschen „Gruselkrimi“ und der Pulp-Literatur. In Miraglias LA DAMA UCCIDE SETTE VOLTE wird das besonders deutlich: Die Geschichte um einen jahrhundertealten Fluch, der die Schwestern der Familie Wildenbruck in eine mörderische Intrige stürzt, sucht sie auch in der Gegenwart heim, in der die schöne Kitty (Barbara Bouchet) in den Glauben versetzt wird, das neuester Opfer ihrer toten Schwester Eveline, der titelgebenden „roten Königin“ zu sein. Natürlich hat die Mordserie, die im Zentrum des Filmes steht, höchst weltliche Gründe: Wie in vielen Edgar-Wallace-Filmen, die eine wichtige Inspiration für den Giallo waren, geht es um eine Erbschaft und der Fluch, den man offiziell als lächerliche Legende abtut, insgeheim aber doch fürchtet, ist nur eine willkommene Tarnung für die wahren Motive des Täters. Darunter schwelen ungelöste Geschwisterkonflikte, sexuelle Perversionen und bizarre Neurosen. Ein Giallo aus der untersten Schublade: Elizabeth (Erna Schurer) ist die rechtmäßige Erbin eines Schlosses, dessen ursprünglicher Besitzer unter mysteriösen Umständen verstorben ist. Bald wird sie von nächtlichen Erscheinungen heimgesucht und überdies verschwindet der Notar spurlos. Offensichtlich will sie jemand zum Verkauf des alten Kastens bringen, in dessen Keller sich wertvolles Uran befindet …
Ein Giallo aus der untersten Schublade: Elizabeth (Erna Schurer) ist die rechtmäßige Erbin eines Schlosses, dessen ursprünglicher Besitzer unter mysteriösen Umständen verstorben ist. Bald wird sie von nächtlichen Erscheinungen heimgesucht und überdies verschwindet der Notar spurlos. Offensichtlich will sie jemand zum Verkauf des alten Kastens bringen, in dessen Keller sich wertvolles Uran befindet … FLOWERS IN THE ATTIC ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine uninspirierte Regie einem potenziell spannenden Film im Wege stehen kann. V. C. Andrews gleichnamiger Bestseller bietet mehr als genug Stoff für anregende Unterhaltung: Das moderne Schauermärchen handelt von vier Geschwistern (u. a. Kristy Swanson und Jeb Stuart Adams), die nach dem überraschenden Tod ihres Vaters von der Mutter (Victoria Tennant) nicht nur allein gelassen, sondern im riesigen Haus der religiös fanatischen Großmutter (Louise Fletcher) eingesperrt und langsam vergiftet werden. Während sie sich langsam mit der fürchterlichen Erkenntnis arrangieren müsssen, dass sie völlig allein sind, gilt es, einen Ausweg aus ihrem Gefängnis zu finden …
FLOWERS IN THE ATTIC ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine uninspirierte Regie einem potenziell spannenden Film im Wege stehen kann. V. C. Andrews gleichnamiger Bestseller bietet mehr als genug Stoff für anregende Unterhaltung: Das moderne Schauermärchen handelt von vier Geschwistern (u. a. Kristy Swanson und Jeb Stuart Adams), die nach dem überraschenden Tod ihres Vaters von der Mutter (Victoria Tennant) nicht nur allein gelassen, sondern im riesigen Haus der religiös fanatischen Großmutter (Louise Fletcher) eingesperrt und langsam vergiftet werden. Während sie sich langsam mit der fürchterlichen Erkenntnis arrangieren müsssen, dass sie völlig allein sind, gilt es, einen Ausweg aus ihrem Gefängnis zu finden … Wahrscheinlich ist Abraham Lincoln neben George Washington und John F. Kennedy der berühmteste und beliebteste aller US-amerikanischen Präsidenten. Sein Gesicht und seine Gestalt sind unverwechselbar und politisch wird er immer mit dem Ende der Sklaverei und der Wiedervereinigung des zersplitterten Staatenbundes verbunden sein. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er – begünstigt sicherlich durch seine Ermordung – zu einer beinahe mythischen Gestalt aufgestiegen ist. Und John Fords Film unterstreicht das noch. Heute würde man YOUNG MR. LINCOLN vielleicht als „Origin Story“ bezeichnen: Er erfindet auf Basis der historischen Fakten eine Ursprungsgeschichte, die seinen Zuschauern einen Eindruck davon vermitteln soll, wer dieser Abraham Lincoln war, wo er herkam, was ihn prägte und wie er zu dem wurde, der er vermeintlich war. Aber er erhebt nie den Anspruch von trockener Geschichtsschreibung: Manchmal kommt die Mythologisierung der Wahrheit vielleicht sogar näher als die Aneinanderreihung von Tatsachen, die im luftleeren Raum schweben. Ford will inspirieren, einen Traum greifbar machen. Weil die Idee der USA größer ist, als dass sich dies durch nüchterne Beschreibung erklären ließe.
Wahrscheinlich ist Abraham Lincoln neben George Washington und John F. Kennedy der berühmteste und beliebteste aller US-amerikanischen Präsidenten. Sein Gesicht und seine Gestalt sind unverwechselbar und politisch wird er immer mit dem Ende der Sklaverei und der Wiedervereinigung des zersplitterten Staatenbundes verbunden sein. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er – begünstigt sicherlich durch seine Ermordung – zu einer beinahe mythischen Gestalt aufgestiegen ist. Und John Fords Film unterstreicht das noch. Heute würde man YOUNG MR. LINCOLN vielleicht als „Origin Story“ bezeichnen: Er erfindet auf Basis der historischen Fakten eine Ursprungsgeschichte, die seinen Zuschauern einen Eindruck davon vermitteln soll, wer dieser Abraham Lincoln war, wo er herkam, was ihn prägte und wie er zu dem wurde, der er vermeintlich war. Aber er erhebt nie den Anspruch von trockener Geschichtsschreibung: Manchmal kommt die Mythologisierung der Wahrheit vielleicht sogar näher als die Aneinanderreihung von Tatsachen, die im luftleeren Raum schweben. Ford will inspirieren, einen Traum greifbar machen. Weil die Idee der USA größer ist, als dass sich dies durch nüchterne Beschreibung erklären ließe. Für
Für