 HEREDITARY stellt einen radikalen Gegenentwurf zu Muschiettis IT Vorstellung von Horror dar: Statt des gut ausgeleuchteten, jederzeit vorhersehbaren Films um einen Killerclown, der einem Actionhelden gleich im Fünf-Minuten-Takt durch Geisterbahnsettings gehetzt wird, auf dass er sein Teenie-, Hausfrauen- und „Ich-grusel-mich-halt-so-gern“-Publikum erschrecke, gibt es hier Horror, der weitestgehend ohne Schreckgespenst auskommt, seinen Schrecken fast ausschließlich aus dem menschlichen Miteinander bezieht, dabei gleichermaßen verstört und wehtut und auch noch formal einiges zu bieten hat.
HEREDITARY stellt einen radikalen Gegenentwurf zu Muschiettis IT Vorstellung von Horror dar: Statt des gut ausgeleuchteten, jederzeit vorhersehbaren Films um einen Killerclown, der einem Actionhelden gleich im Fünf-Minuten-Takt durch Geisterbahnsettings gehetzt wird, auf dass er sein Teenie-, Hausfrauen- und „Ich-grusel-mich-halt-so-gern“-Publikum erschrecke, gibt es hier Horror, der weitestgehend ohne Schreckgespenst auskommt, seinen Schrecken fast ausschließlich aus dem menschlichen Miteinander bezieht, dabei gleichermaßen verstört und wehtut und auch noch formal einiges zu bieten hat.
Es dauert nicht lang, bis der Zuschauer merkt, dass in der Familie von Mutter Annie (Toni Collette), Vater Steve (Gabriel Byrne), Sohn Peter (Alex Wolff) und Tochter Charlie (Milly Shapiro) einiges im Argen liegt: Annies tyrannische, psychisch kranke Mutter ist soeben verstorben, eine Familientradition von Geisteskrankheit inklusive Gewalt und Selbstmord lastet auf ihren Schultern – und möglicherweise in ihrem Erbgut? Der Druck, den sie verspürt, wird direkt an die Familie, vor allem an de ungeliebten Sohn Peter, weitergegeben. Als Charlie, Lieblingskind sowohl der toten Oma als auch der Mutter und selbst in einer eigenen Welt lebend, in Peters Obhut bei einem bizarren Unfall sprichwörtlich den Kopf verliert und ums Leben kommt, zerfällt auch noch der letzte Anschein eines zivilisierten Miteinanders. Dass die eh schon am Rande des Nervenzusammenbruchs balancierende Annie mithilfe der freundlichen Joan (Ann Dowd) Kontakt zur toten Tochter aufnimmt, ist nur der letzte Schritt in die eh schon vorprogrammierte Katastrophe: Peter wird von einem aggressiven Geist heimgesucht, der sich für den Tod an Charlie rächen zu wollen scheint. Es sieht so aus, als sei die Oma mit okkulten Mächten im Bunde gewesen. Oder sind das alles nur die Hirngespinste Annies, bei der die Geisteskrankheit sich nun manifestiert?
Wie die meisten Horrorfilme, die diese Schnittstelle zwischen Psychologie und Übersinnlichkeit beackern, entscheidet sich auch Regisseur Ari Aster gegen Ende zumindest vordergründig zugunsten der letzteren. Ich schätze, dass ich das Ende von HEREDITARY noch vor 10, 15 Jahren als handfeste Enttäuschung empfunden hätte, aber heute kann ich sehr gut damit leben. Mehr noch: HEREDITARY ist locker einer der stärksten und eigenständigsten Horrorfilme der letzten Jahre, selbst wenn seine Vorbilder unverkennbar sind. Vor allem ROSEMARY’S BABY muss natürlich als Inspirationsquelle genannt werden, THE EXORCIST wäre eine weitere, aber es ist nicht nötig, bis ins Golden Age zurückgehen, um Artverwandte zu finden. Das arg tendenziöse Review im Slant Magazine zieht sogar Parallelen zu den Filmen Wes Andersons, vermutlich in der Absicht, Aster ein „Style over Substance“ vorzuwerfen, womit er gleich beiden Unrecht tut. HEREDITARY verwendet die detailverliebten Dioramen, die seine Protagonistin in obsessiver Feinarbeit anfertigt, als eine Art Leitmotiv sowie als formales Leitbild: Die Räume des Hauses werden immer wieder so inszeniert, als schaue der Betrachter in einen Kasten, eine Technik, die mich mehr als einmal an Mendes‘ AMERICAN BEAUTY erinnert hat, der sie zu einem ähnlichen, wenngleich auch deutlich weniger verstörenden Effekt einsetzt. Aster beginnt direkt damit, fährt mit der Kamera ganz dicht an eines der Puppenhäuser in Annies Atelier heran, bis sich die Puppen darin als Peter und Steve entpuppen. Immer wieder baut Aster gezielt auf die Täuschung des Zuschauers, für den sich die vermeintliche Realität bei näherer Betrachtung als ihre Miniaturabbildung entpuppt. Ein Hinweis auf die Dramen, die sich nur in Annies Kopf abspielen, von ihr aber als „wahr“ empfunden werden: Vor allem zum Ende hin, wenn die Mutter dem Abgrund entgegentaumelt, häufen sich Szenen, in denen sich die Realität als Albtraum oder auch als Albtraum im Albtraum entpuppt und es keinen Ausweg aus dem Wahnsinn mehr zu geben scheint. Gleichzeitig bewahrt Aster sich die Ruhe des allmächtigen Puppenspielers, der die Fäden immer in der Hand hat, auch wenn sie für den Betrachter hoffnungslos verknotet sind. Es ist auch diese Ruhe, die den Film so wirkungsvoll macht.
Im Zeitlupentempo kriecht er voran, entfaltet in aller Ruhe und mit einer geduldigen Kamera, die geradezu in die Köpfe der Protagonisten einzudringen sucht, ein Familiendrama, das mit jeder Sekunde unerträglicher wird. Die Scares und Schocks sitzen, aber als noch verstörender empfand ich die Szenen, in denen ich dabei zusehen musste, wie jedes einzelne Mitglied dieser Familie zugrunde gerichtet wird durch das Unausgesprochene, das sich nun Ausdruck verschafft, wie da lang zurück gehaltene Gefühle einmal losgelassen eine Wucht entwickeln, vor der nichts Stand hält und wie die als Resultat herausgeschleuderten Worte Leben vernichten. Die Szene, in der Peter begreift, dass er für den Tod seiner Schwester mitverantwortlich ist? Wie er sich stumm in sein Bett schleicht und regungslos die Schreie der Mutter hört, als die die kopflose Leiche ihrer Tochter findet? Niederschmetternd. Als die Trauer über den Tod Charlies sich in einer Hasstirade gegen den eigenen Sohn Luft macht, der ihren Angriffen wehrlos ausgeliefert ist? Verheerend. Wie er nach einem Albtraum aufwacht, die Mutter bei ihm im Zimmer steht und er annehmen muss, dass sie ihn umbringen wollte? Unbeschreiblich. Toni Collette und Alex Wolff agieren an unterschiedlichen Enden des Spektrums, sie ein kurz vor der Explosion stehendes Nervenbündel, er ein immer mehr in sich zusammensackender, sich unter dem Druck beinahe in Luft auflösender Tropf, und die ungleiche Kräfteverteilung verleiht dem Film im Wesentliche seine Spannung. Beide sind grandios. Zwischen ihnen steht Gabriel Byrnes Steve, dessen verzweifelte Versuche, den Frieden zu wahren, die Fassade aufrechtzuerhalten, so bemitleidenswert wie verblendet sind. Er ist weniger auffällig als seine Kollegen, aber für das Gelingen des Films absolut zentral: Er ist das Auge des Tornados, der ruhende Pol, um den das Chaos seine Bahnen ziehen kann. Aster entwickelt mithilfe seiner Charaktere eine Dynamik, nein, er entfacht einen Sturm, der, einmal losgelassen, unaufhaltsam ist. Die verstorbene Oma mag die mächtige Puppenspielerin gewesen sein, die den entscheidenden Impuls gab – ob als Okkultistin oder schlicht als Träger einer vererblichen Geisteskrankheit – aber ihre Nachfahren sind nie in der Lage, sich ihrem Einfluss zu entziehen und die Fäden zu zerschneiden. Es gelingt ihnen nicht, aus dem Puppenhaus herauszutreten und von außen auf sich, ihre Welt, ihr Leben und ihr Miteinander zu blicken. HEREDITARY ist eine griechische Tragödie im Gewand eines Horrorfilms.
 Über diesen Film zu schreiben und dabei etwas Gehaltvolles zu sagen, ohne auf die große Überraschung hinzuweisen, die den Zuschauer am Ende erwartet, scheint mir nahezu unmöglich. Ich versuche es trotzdem, weil ich niemandem den Spaß verderben will. Und fange konservativ an.
Über diesen Film zu schreiben und dabei etwas Gehaltvolles zu sagen, ohne auf die große Überraschung hinzuweisen, die den Zuschauer am Ende erwartet, scheint mir nahezu unmöglich. Ich versuche es trotzdem, weil ich niemandem den Spaß verderben will. Und fange konservativ an. Als ich in den Neunzigerjahren begann, die Splatting Image zu lesen, gab es eine Textreihe von Bodo Traber, die sich mit dem sogenannten „Paranoia-Film“ beschäftigte. Ich wusste zwar, was sich unter dem Begriff der „Paranoia“ verbarg, aber die Methode, Filme quasi motivisch zu sortieren, war mir neu. Was sollte das sein, ein „Paranoia-Film“, was hatten die doch sehr unterschiedlichen Filme, die Traber besprach, miteinander gemein? Mit den Jahren verstand ich besser, dass der Paranoia-Film keine willkürlich erfundene Kategorie war, sondern dass tatsächlich viele Genres und Subgenres ganz natürlich um das Gefühl einer alles niederdrückenden, zermalmenden Angst kreisen: Horrorfilme, Science-Fiction- und Invasionsfilme, Psychothriller, Serienmörderfilme, Monster- und Katastrophenfilme, Kriegsfilme und etliche mehr. Trotzdem war Paranoia ein Thema, dass mit dem Leben, wie ich es kannte, nur wenig zu tun hatte. Das hat sich in den letzten 15 Jahren massiv gewandelt und heute neige ich fast zu der These, dass der Verfolgungswahn und die Angst, von einem übermächtigen, nicht greifbaren Feind bedroht zu werden, zu einer Art Volkskrankheit geworden sind.
Als ich in den Neunzigerjahren begann, die Splatting Image zu lesen, gab es eine Textreihe von Bodo Traber, die sich mit dem sogenannten „Paranoia-Film“ beschäftigte. Ich wusste zwar, was sich unter dem Begriff der „Paranoia“ verbarg, aber die Methode, Filme quasi motivisch zu sortieren, war mir neu. Was sollte das sein, ein „Paranoia-Film“, was hatten die doch sehr unterschiedlichen Filme, die Traber besprach, miteinander gemein? Mit den Jahren verstand ich besser, dass der Paranoia-Film keine willkürlich erfundene Kategorie war, sondern dass tatsächlich viele Genres und Subgenres ganz natürlich um das Gefühl einer alles niederdrückenden, zermalmenden Angst kreisen: Horrorfilme, Science-Fiction- und Invasionsfilme, Psychothriller, Serienmörderfilme, Monster- und Katastrophenfilme, Kriegsfilme und etliche mehr. Trotzdem war Paranoia ein Thema, dass mit dem Leben, wie ich es kannte, nur wenig zu tun hatte. Das hat sich in den letzten 15 Jahren massiv gewandelt und heute neige ich fast zu der These, dass der Verfolgungswahn und die Angst, von einem übermächtigen, nicht greifbaren Feind bedroht zu werden, zu einer Art Volkskrankheit geworden sind. Der deutsche Titel MACABRO – DIE KÜSSE DER JANE BAXTER begleitet mich auch schon seit Jahrzehnten, dank des Horrorfilm-Lexikons aus dem Hause Hahn/Jansen. Die Inhaltsangabe empfand ich aber als ziemlich verstörend und malte mir den Film immer als kalten, handlungsarmen Kunstschocker aus. Dieses Bild verfing sich irgendwie durch Selbstsuggestion: Auch als ich längst wusste, wer dieser Bava ist und was für Filme er sonst so machte, traute ich mich an sein Regiedebüt nicht so recht heran. Wer weiß, wofür es gut war, denn immerhin kann ich heute verlautbaren, dass Bava mit MACABRO einen Einstand nach Maß feierte und gleich einen seiner besten Filme vorlegte (soweit ich das beurteilen kann, denn es gibt da noch viele Lücken, die ich zu schließen habe). Will sagen: MACABRO ist toll.
Der deutsche Titel MACABRO – DIE KÜSSE DER JANE BAXTER begleitet mich auch schon seit Jahrzehnten, dank des Horrorfilm-Lexikons aus dem Hause Hahn/Jansen. Die Inhaltsangabe empfand ich aber als ziemlich verstörend und malte mir den Film immer als kalten, handlungsarmen Kunstschocker aus. Dieses Bild verfing sich irgendwie durch Selbstsuggestion: Auch als ich längst wusste, wer dieser Bava ist und was für Filme er sonst so machte, traute ich mich an sein Regiedebüt nicht so recht heran. Wer weiß, wofür es gut war, denn immerhin kann ich heute verlautbaren, dass Bava mit MACABRO einen Einstand nach Maß feierte und gleich einen seiner besten Filme vorlegte (soweit ich das beurteilen kann, denn es gibt da noch viele Lücken, die ich zu schließen habe). Will sagen: MACABRO ist toll. Warum dieser Film kein heiß und innig geliebter Klassiker von Freunden düsterer Serienmord-Thriller ist, ist mir ein Rätsel. Liegt es vielleicht daran, dass allzu viele seiner potenziellen Verehrer ihn aufgrund seines weitaus bekannteren Titels CHRISTMAS EVIL für bloß einen weiteren Slasherfilm mit Weihnachtsbezug gehalten und deshalb gemieden haben? Ich gebe zu, auch selbst auf die Suggestionen von Titel und DVD-Cover hereingefallen zu sein, hätte auch nichts gegen eine SILENT NIGHT, DEADLY NIGHT-Variante gehabt, wurde so aber völlig auf dem falschen Fuß erwischt und mehr als positiv überrascht. Puh, was für ein finsteres kleiner Bastard!
Warum dieser Film kein heiß und innig geliebter Klassiker von Freunden düsterer Serienmord-Thriller ist, ist mir ein Rätsel. Liegt es vielleicht daran, dass allzu viele seiner potenziellen Verehrer ihn aufgrund seines weitaus bekannteren Titels CHRISTMAS EVIL für bloß einen weiteren Slasherfilm mit Weihnachtsbezug gehalten und deshalb gemieden haben? Ich gebe zu, auch selbst auf die Suggestionen von Titel und DVD-Cover hereingefallen zu sein, hätte auch nichts gegen eine SILENT NIGHT, DEADLY NIGHT-Variante gehabt, wurde so aber völlig auf dem falschen Fuß erwischt und mehr als positiv überrascht. Puh, was für ein finsteres kleiner Bastard! Noch bevor ich überhaupt wusste, worum es in dem Film überhaupt geht, wusste ich, dass er ein „Skandalfilm“ ist. Wenn es um DER FAN geht, dauert es garantiert nicht lang, bis der Begriff fällt, und natürlich habe auch ich heute, als ich Kollegen von DER FAN erzählt habe, denen der Titel unbekannt war, selbst auf diese Kategorisierung zurückgegriffen. Man macht damit sofort klar, dass man nicht nur irgendeinen alten Film gesehen hat, sondern einen, der für einen kurzen Moment einmal die Gemüter erregt hatte, eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung erlangte. Lustigerweise soll das Wort „Skandalfilm“ so verwendet eine gewisse Respektabilität bringen, anstatt zu stigmatisieren. Das zeigt natürlich auch, wie unsinnig es ist, mit solchen Begriffen, die binnen von 30 Jahren komplett ihre Bedeutung verlieren, überhaupt zu operieren. Die Aufregung um DER FAN hat sich natürlich irgendwann gelegt, und 2003 wurde der Film sogar vom Index genommen. Heute ist der Weg frei für seine Neubewertung unter künstlerischen Gesichtspunkten. Sicherlich mag er auf manche auch heute noch allein wegen der Tatsache, dass die damals 16-jährige Désirée Nosbusch darin in ihrer ganzen jugendlichen Pracht zu sehen ist, eine gewisse Anziehungskraft ausüben (warum auch nicht, sie war ja tatsächlich sehr hübsch), aber das ist eher zu vernachlässigen. Wer sich DER FAN heute aus der Distanz anschaut, der wird wahrscheinlich darüber staunen, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit damals an etwas so Oberflächlichem wie der Nacktheit der Hauptdarstellerin aufhing. Vielleicht war das eine Schutzmaßnahme, denn alles andere an DER FAN ist noch deutlich verstörender als es jede vermeintliche „Ausbeutung“ gewesen sein könnte (die Nosbusch klagte kurz nach Erscheinen des Films, weil sie behauptete, man habe ihr die Zusage gegeben, ihre Nacktszenen zu kürzen).
Noch bevor ich überhaupt wusste, worum es in dem Film überhaupt geht, wusste ich, dass er ein „Skandalfilm“ ist. Wenn es um DER FAN geht, dauert es garantiert nicht lang, bis der Begriff fällt, und natürlich habe auch ich heute, als ich Kollegen von DER FAN erzählt habe, denen der Titel unbekannt war, selbst auf diese Kategorisierung zurückgegriffen. Man macht damit sofort klar, dass man nicht nur irgendeinen alten Film gesehen hat, sondern einen, der für einen kurzen Moment einmal die Gemüter erregt hatte, eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung erlangte. Lustigerweise soll das Wort „Skandalfilm“ so verwendet eine gewisse Respektabilität bringen, anstatt zu stigmatisieren. Das zeigt natürlich auch, wie unsinnig es ist, mit solchen Begriffen, die binnen von 30 Jahren komplett ihre Bedeutung verlieren, überhaupt zu operieren. Die Aufregung um DER FAN hat sich natürlich irgendwann gelegt, und 2003 wurde der Film sogar vom Index genommen. Heute ist der Weg frei für seine Neubewertung unter künstlerischen Gesichtspunkten. Sicherlich mag er auf manche auch heute noch allein wegen der Tatsache, dass die damals 16-jährige Désirée Nosbusch darin in ihrer ganzen jugendlichen Pracht zu sehen ist, eine gewisse Anziehungskraft ausüben (warum auch nicht, sie war ja tatsächlich sehr hübsch), aber das ist eher zu vernachlässigen. Wer sich DER FAN heute aus der Distanz anschaut, der wird wahrscheinlich darüber staunen, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit damals an etwas so Oberflächlichem wie der Nacktheit der Hauptdarstellerin aufhing. Vielleicht war das eine Schutzmaßnahme, denn alles andere an DER FAN ist noch deutlich verstörender als es jede vermeintliche „Ausbeutung“ gewesen sein könnte (die Nosbusch klagte kurz nach Erscheinen des Films, weil sie behauptete, man habe ihr die Zusage gegeben, ihre Nacktszenen zu kürzen).
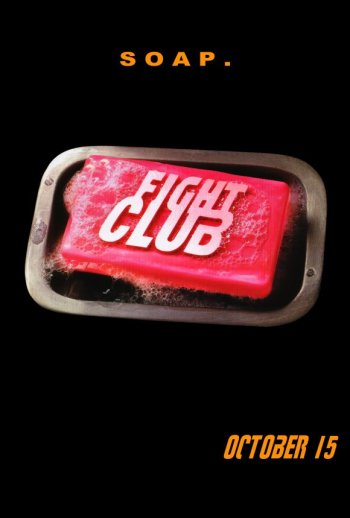
 Ärzte und Gutachter stehen vor einem Rätsel, als Michael O’Brien (Robin Ward) eines Tages aus heiterem Himmel einen grausamen Ritualmord verübt. Es gibt keinerlei Erklärung, warum aus dem zurückhaltenden jungen Mann plötzlich ein Mörder wurde. Sein eineiiger Zwillingsbruder Sean (Robin Ward) ist nicht nur geschockt, sondern auch verängstigt: Steht ihm eine ähnliche Verwandlung bevor? Eine Sorge, die seine Ehe mit Dale (Wendy Crewson) merklich belastet. Als er Michael 15 Jahre nach der schrecklichen Tat offenbart, dass er gedenkt das familieneigene Anwesen zu verkaufen, brennt bei dem durch die Isolation der Haft eh schon unter Spannung stehenden Mann erneut eine Sicherung durch: Er ermordet eine Krankenschwester und flieht aus der Heilanstalt …
Ärzte und Gutachter stehen vor einem Rätsel, als Michael O’Brien (Robin Ward) eines Tages aus heiterem Himmel einen grausamen Ritualmord verübt. Es gibt keinerlei Erklärung, warum aus dem zurückhaltenden jungen Mann plötzlich ein Mörder wurde. Sein eineiiger Zwillingsbruder Sean (Robin Ward) ist nicht nur geschockt, sondern auch verängstigt: Steht ihm eine ähnliche Verwandlung bevor? Eine Sorge, die seine Ehe mit Dale (Wendy Crewson) merklich belastet. Als er Michael 15 Jahre nach der schrecklichen Tat offenbart, dass er gedenkt das familieneigene Anwesen zu verkaufen, brennt bei dem durch die Isolation der Haft eh schon unter Spannung stehenden Mann erneut eine Sicherung durch: Er ermordet eine Krankenschwester und flieht aus der Heilanstalt … Als LA SINDROME DI STENDHAL 1996 das Licht der Welt erblickte – nach zwei Filmen (LA DUE OCCHI DIABOLICI und
Als LA SINDROME DI STENDHAL 1996 das Licht der Welt erblickte – nach zwei Filmen (LA DUE OCCHI DIABOLICI und