![YOURE%20NEVER%20TOO%20YOUNG%20ARG[1] YOURE%20NEVER%20TOO%20YOUNG%20ARG[1]](https://funkhundd.files.wordpress.com/2009/05/youre20never20too20young20arg1.jpg?w=209&h=300) Weil ein vom Verbrecher Noonan (Raymond Burr) gestohlener Edelstein auf Umwegen in der Hosentasche des Friseurgehilfen Wilbur Hoolick (Jerry Lewis) landet, muss dieser die Stadt verlassen. Als er am Bahnhof ernüchtert feststellt, dass ihm für ein Erwachsenenticket das nötige Geld fehlt, klaut er kurzerhand einem Elfjährigen den Matrosenanzug und schleicht sich so an Bord. Die Lehrerin Nancy (Diana Lynn) hat Mitleid mit dem „Kleinen“ und lässt ihn in ihrer Kabine übernachten. Damit geht der Ärger erst los, denn Nancys Kollegin Gretchen (Nina Foch), die es wiederum auf Nancys Liebhaber, den Musik- und Sportlehrer Bob Miles (Dean Martin), abgesehen hat, streut sofort das Gerücht, dass Nancy ein Verhältnis mit einem Fremden habe. Das bringt Bob auf den Plan, der Wilbur nun auf den Zahn zu fühlen beginnt. Ist er wirklich ein Kind oder doch ein erwachsener Mann? Und in der Zwischenzeit hat auch Noonan die Verfolgung aufgenommen …
Weil ein vom Verbrecher Noonan (Raymond Burr) gestohlener Edelstein auf Umwegen in der Hosentasche des Friseurgehilfen Wilbur Hoolick (Jerry Lewis) landet, muss dieser die Stadt verlassen. Als er am Bahnhof ernüchtert feststellt, dass ihm für ein Erwachsenenticket das nötige Geld fehlt, klaut er kurzerhand einem Elfjährigen den Matrosenanzug und schleicht sich so an Bord. Die Lehrerin Nancy (Diana Lynn) hat Mitleid mit dem „Kleinen“ und lässt ihn in ihrer Kabine übernachten. Damit geht der Ärger erst los, denn Nancys Kollegin Gretchen (Nina Foch), die es wiederum auf Nancys Liebhaber, den Musik- und Sportlehrer Bob Miles (Dean Martin), abgesehen hat, streut sofort das Gerücht, dass Nancy ein Verhältnis mit einem Fremden habe. Das bringt Bob auf den Plan, der Wilbur nun auf den Zahn zu fühlen beginnt. Ist er wirklich ein Kind oder doch ein erwachsener Mann? Und in der Zwischenzeit hat auch Noonan die Verfolgung aufgenommen …
Nach der quasiavantgardistischen Herangehensweise von Tashlin in HOLLYWOOD OR BUST mutet YOU’RE NEVER TOO YOUNG wieder etwas bodenständiger an. Im Mittelpunkt stehen die Zoten Lewis‘ und die Gesangsnummern Martins, die dementsprechend beide ausreichend Gelegenheit bekommen, ihrem jeweiligen Talent zu frönen. Der eigentliche Plot gerät dabei ins Hintertreffen und mehr als einmal wird man vom Auftauchen Noonans förmlich überrascht: Ach ja, da war ja noch was. So treten die dramatischen Verwicklungen um Wilburs Identität in den Mittelpunkt: Dass er als Kind agieren muss, wird entgegen meinen Erwartungen nicht ausschließlich für grellen Slapstick genutzt – es gab eigentlich nur eine Szene, die sich so abspielt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dennoch gibt es zahlreiche schreiend komische Momente: Am meisten gelacht habe ich bei Lewis‘ schlicht brillanter Humphrey-Bogart-Imitation, die einfach nur für die Ewigkeit gemacht ist. Wer mit den Martin/Lewis-Filmen vertraut ist, wird sich also auch hier sofort heimisch fühlen, die Leichtigkeit des Vortrags, die Unbeschwertheit und Naivität und auch diesen gewissen altmodischen Hollywood-Charme genießen. YOU’RE NEVER TOO YOUNG – übrigens ein Remake des Billy-Wilder-Frühwerks THE MAJOR AND THE MINOR der Ginger Rogers in der Lewis-Rolle aufbietet – ist eines jener berüchtigten Entertainment-Pakete, die Hollywood damals zu schnüren pflegte: ein bisschen Humor, ein bisschen was fürs Herz, ein bisschen Musik und Tanz und am Schluss eine zünftige Verfolgungsjagd – fertig ist der Film für die ganze Familie. Aber Vorsicht: Dieses Etikett täuscht nämlich nicht darüber hinweg, dass es hier gerade aus heutiger Sicht ziemlich abgründig zugeht. Wenn Wilbur den kleinen Jungen am Bahnhof mit rollenden Augen, diabolischem Grinsen und mithilfe wilder Spielzeugversprechungen auf das Klo lockt, um ihm dort die Kleidung zu stehlen, ist das nur der offensichtlichste Hinweis auf die sexuellen Implikationen der Verkleidungsposse. Überhaupt: Es geht nur um Sex. Auf der einen Seite hat man den im unerfüllten Liebesglück schwelgenden Wilbur, der seine Verkleidung und die Unbedarftheit Nancys zu zwar eindeutigen, aber eben immer als unschuldig interpretierten Annäherungen nutzt, auf der anderen den öligen Dean Martin, dem keine Gelegenheit und kein Ort unpassend erscheinen, um eines seiner schmalzigen Liebeslieder zu singen. Hinter seiner Gentlemanfassade verbirgt sich ein sexuelles Raubtier, das nicht zu bändigen ist und dessen mit jedem Film erneuerten Ehebemühungen man als Zuschauer kaum noch ernst nehmen kann. Je mehr Filme des Duos ich sehe, umso mehr Ebenen erhalten diese. Ich würde sie aber auch einfach „nur so“ gucken, weil sie so herrlich bunt sind.
![416839.1010.A[1] 416839.1010.A[1]](https://funkhundd.files.wordpress.com/2009/05/416839-1010-a1.jpg?w=196&h=300) Der New Yorker Ganove Steve Wiley (Dean Martin) sitzt in der Patsche: Er steht bei seinem Buchmacher mit 3.000 Dollar in der Kreide. Doch er hat schon einen Plan, wie er das Geld auftreiben kann. Mithilfe eines gefälschten Loses will er bei einer öffentlichen Tombola den Hauptpreis, ein nagelneues Auto, gewinnen. Der Plan scheint zu gelingen, doch dann kommt ihm der Besitzer des echten Gewinnertickets, Malcolm Smith (Jerry Lewis), in die Quere. Weil der Veranstalter nun beide als rechtmäßige Gewinner anerkennt, hat Wiley ein neues Problem: Er muss den anhänglichen Malcolm loswerden, um das Auto in bares Geld zu verwandeln. Doch Malcolm, ein Filmfan wie er im Buche steht, hat nur ein Ziel – Hollywood! Und seine dänische Dogge Mr. Bascomb weiß alle Versuche Wileys, seinen ungewollten Partner wieder loszuwerden, zu vereiteln …
Der New Yorker Ganove Steve Wiley (Dean Martin) sitzt in der Patsche: Er steht bei seinem Buchmacher mit 3.000 Dollar in der Kreide. Doch er hat schon einen Plan, wie er das Geld auftreiben kann. Mithilfe eines gefälschten Loses will er bei einer öffentlichen Tombola den Hauptpreis, ein nagelneues Auto, gewinnen. Der Plan scheint zu gelingen, doch dann kommt ihm der Besitzer des echten Gewinnertickets, Malcolm Smith (Jerry Lewis), in die Quere. Weil der Veranstalter nun beide als rechtmäßige Gewinner anerkennt, hat Wiley ein neues Problem: Er muss den anhänglichen Malcolm loswerden, um das Auto in bares Geld zu verwandeln. Doch Malcolm, ein Filmfan wie er im Buche steht, hat nur ein Ziel – Hollywood! Und seine dänische Dogge Mr. Bascomb weiß alle Versuche Wileys, seinen ungewollten Partner wieder loszuwerden, zu vereiteln …![74961657ae02e93fc17be9d9fc864620[1] 74961657ae02e93fc17be9d9fc864620[1]](https://funkhundd.files.wordpress.com/2009/05/74961657ae02e93fc17be9d9fc8646201.jpg?w=219&h=300) Charlie (Charles Aznavour) verdient sein Geld als Pianist in einem kleinen Pariser Tanzschuppen und nur sein krimineller Bruder Chico (Albert Remy) erinnert ihn manchmal noch an die große Musikerkarriere, die ihm einst unter seinem echten Namen Edouard Saroyan bevorstand, bevor ihn der Selbstmord seiner Frau Therese (Nicole Berger) aus der Bahn warf. Die Beziehung zur Kellnerin Léna (Marie Dubois) bringt neue Hoffnung in Charlies Leben, doch dann kommt ihm wieder einmal Chico in die Quere: Der steckt in Schwierigkeiten und sucht vor seinen Verfolgern Unterschlupf im abgelegenen Landhaus der Familie Saroyan. Doch weil Charlie das Versteck kennt, klopfen die Verbrecher bald schon bei ihm an …
Charlie (Charles Aznavour) verdient sein Geld als Pianist in einem kleinen Pariser Tanzschuppen und nur sein krimineller Bruder Chico (Albert Remy) erinnert ihn manchmal noch an die große Musikerkarriere, die ihm einst unter seinem echten Namen Edouard Saroyan bevorstand, bevor ihn der Selbstmord seiner Frau Therese (Nicole Berger) aus der Bahn warf. Die Beziehung zur Kellnerin Léna (Marie Dubois) bringt neue Hoffnung in Charlies Leben, doch dann kommt ihm wieder einmal Chico in die Quere: Der steckt in Schwierigkeiten und sucht vor seinen Verfolgern Unterschlupf im abgelegenen Landhaus der Familie Saroyan. Doch weil Charlie das Versteck kennt, klopfen die Verbrecher bald schon bei ihm an …![A70-10818[1] A70-10818[1]](https://funkhundd.files.wordpress.com/2009/05/a70-1081811.jpg?w=197&h=300) Das Altamont-Festival, das während des Auftritts der Rolling Stones in einem durch ein Hell’s-Angels-Mitglied verübten Mord an einem Schwarzen kulminierte, stellt in der Rezeptions- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts so etwas wie den Sündenfall der Hippiebewegung dar. All die Hoffnungen auf ein friedliches Miteinander, die diese Bewegung einten, zerbrachen (spätestens) an diesem Tag und läuteten den Niedergang der in den Sechzigerjahren begonnenen Friedensbewegung ein. Freie Liebe, Halluzinogene, Blumen, Love-ins und Meditation konnten nichts an der Tatsache ändern, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, der an diesem Tag im Winter 1969 seine Zähne zeigte.
Das Altamont-Festival, das während des Auftritts der Rolling Stones in einem durch ein Hell’s-Angels-Mitglied verübten Mord an einem Schwarzen kulminierte, stellt in der Rezeptions- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts so etwas wie den Sündenfall der Hippiebewegung dar. All die Hoffnungen auf ein friedliches Miteinander, die diese Bewegung einten, zerbrachen (spätestens) an diesem Tag und läuteten den Niedergang der in den Sechzigerjahren begonnenen Friedensbewegung ein. Freie Liebe, Halluzinogene, Blumen, Love-ins und Meditation konnten nichts an der Tatsache ändern, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, der an diesem Tag im Winter 1969 seine Zähne zeigte.![991914887_0b568456_Mishima-A%2BLife%2BIn%2BFour%2BChapters28198529[1] 991914887_0b568456_Mishima-A%2BLife%2BIn%2BFour%2BChapters28198529[1]](https://funkhundd.files.wordpress.com/2009/05/991914887_0b568456_mishima-a2blife2bin2bfour2bchapters281985291.jpg?w=213&h=300) Das erste Mal las ich über Mishima in Javier Marias‘ ausgezeichnetem und hiermit empfohlenem Buch „Geschriebenes Leben“: Der kurze Text über den japanischen Dichter faszinierte mich so sehr, dass ich mir direkt im Anschluss Mishimas autobiografischen Roman „Geständnis einer Maske“ zu Gemüte führte. Die Geschichte dieses radikalen Ästheten, der eine Einheit von Leben und Werk anstrebte, sein Leben dazu permanent ästhetisierte und 1970 im Alter von 45 Jahren mit dem Ritual des Seppuku aus dem Leben schied, nachdem er mit seiner Privatarmee in eine japanische Kaserne eingedrungen war, mutet wie die Geschichte eines Irren an, dient als eindrückliches Beispiel dafür, welche kuriosen Blüten eine fehlgeleitete Sozialisation treiben kann. Mishima übte auf mich die Faszination aus, die auch Tyrannen oder Serienmörder auslösen. Und ich fand die Vorstellung eines Intellektuellen, der seinen Körper stählt, sich auf homoerotischen Fotos in Szene setzen lässt und eine Privatarmee williger Jünger unterhält, mit der er Japan zu verbessern gedenkt, geradezu haarsträubend komisch.
Das erste Mal las ich über Mishima in Javier Marias‘ ausgezeichnetem und hiermit empfohlenem Buch „Geschriebenes Leben“: Der kurze Text über den japanischen Dichter faszinierte mich so sehr, dass ich mir direkt im Anschluss Mishimas autobiografischen Roman „Geständnis einer Maske“ zu Gemüte führte. Die Geschichte dieses radikalen Ästheten, der eine Einheit von Leben und Werk anstrebte, sein Leben dazu permanent ästhetisierte und 1970 im Alter von 45 Jahren mit dem Ritual des Seppuku aus dem Leben schied, nachdem er mit seiner Privatarmee in eine japanische Kaserne eingedrungen war, mutet wie die Geschichte eines Irren an, dient als eindrückliches Beispiel dafür, welche kuriosen Blüten eine fehlgeleitete Sozialisation treiben kann. Mishima übte auf mich die Faszination aus, die auch Tyrannen oder Serienmörder auslösen. Und ich fand die Vorstellung eines Intellektuellen, der seinen Körper stählt, sich auf homoerotischen Fotos in Szene setzen lässt und eine Privatarmee williger Jünger unterhält, mit der er Japan zu verbessern gedenkt, geradezu haarsträubend komisch.![longweekend[1] longweekend[1]](https://funkhundd.files.wordpress.com/2009/05/longweekend1.jpg?w=210&h=300) Jamie Blanks‘ LONG WEEKEND war für mich das einsame Highlight bei den diesjährigen Fantasy Filmfest Nights. Die sehr ausgewogene Mischung aus Ökohorror, Ehedrama und Psychothriller ergänzt sich zu einem ausgesprochen unangenehmen, abgründigen Schocker, der genau das hält, was Blanks Vorgänger
Jamie Blanks‘ LONG WEEKEND war für mich das einsame Highlight bei den diesjährigen Fantasy Filmfest Nights. Die sehr ausgewogene Mischung aus Ökohorror, Ehedrama und Psychothriller ergänzt sich zu einem ausgesprochen unangenehmen, abgründigen Schocker, der genau das hält, was Blanks Vorgänger 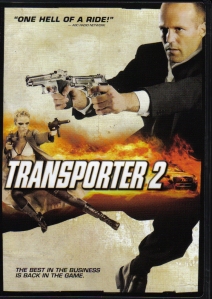 Frank Martin (Jason Statham) ist professioneller Fahrer. Normalerweise ist es seine Aufgabe, heiße Ware zu befördern oder Fluchtwagen zu fahren, derzeit hat er einen vergleichsweise gemütlichen Auftrag: Er ist Chauffeur für den kleinen Jack (Hunter Clary), den Sohn des Staatsbeamten Jefferson Billings (Matthew Modine). Als Jack entführt wird, ist es für Frank selbstverständlich, sich auf die Suche nach ihm zu machen. Doch hinter der Entführung verbirgt sich mehr als eine Lösegelderpressung …
Frank Martin (Jason Statham) ist professioneller Fahrer. Normalerweise ist es seine Aufgabe, heiße Ware zu befördern oder Fluchtwagen zu fahren, derzeit hat er einen vergleichsweise gemütlichen Auftrag: Er ist Chauffeur für den kleinen Jack (Hunter Clary), den Sohn des Staatsbeamten Jefferson Billings (Matthew Modine). Als Jack entführt wird, ist es für Frank selbstverständlich, sich auf die Suche nach ihm zu machen. Doch hinter der Entführung verbirgt sich mehr als eine Lösegelderpressung … Die Krankenschwester Anna (Naomi Watts) bringt das Kind einer 14-jährigen russischen Prostituierten zur Welt, die die Geburt nicht überlebt. Anna beginnt, Nachforschungen über die junge Frau anzustellen und macht dabei die Bekanntschaft einer russischen Mafiafamilie, die von Semyon (Armin Müller-Stahl) geführt wird. Bald lernt sie auch dessen Sohn Kirill (Vincent Cassel) und den „Fahrer“ Nikolai (Viggo Mortensen) kennen, der das Vetrauen der Ärztin gewinnt …
Die Krankenschwester Anna (Naomi Watts) bringt das Kind einer 14-jährigen russischen Prostituierten zur Welt, die die Geburt nicht überlebt. Anna beginnt, Nachforschungen über die junge Frau anzustellen und macht dabei die Bekanntschaft einer russischen Mafiafamilie, die von Semyon (Armin Müller-Stahl) geführt wird. Bald lernt sie auch dessen Sohn Kirill (Vincent Cassel) und den „Fahrer“ Nikolai (Viggo Mortensen) kennen, der das Vetrauen der Ärztin gewinnt … Sidney Falco (Tony Curtis), ein junger, ehrgeiziger Presseagent, versucht alles, um so berühmt und mächtig zu werden wie der Journalist J. J. Hunsecker (Burt Lancaster), dessen Zeitungsrubrik Karrieren ebenso schnell starten wie zerstören kann. Doch Hunsecker lässt Sidney immer wieder abblitzen, bis er eine Chance sieht, wie ihm der Emporkömmling nützlich sein könnte: Falco soll seine Kontakte nutzen, um den jungen Musiker Steve Dallas (Martin Milner) öffentlich zu denunzieren, der mit Hunseckers Schwester Susan (Susan Harrison) liiert ist. Hunsecker will seine Schwester nämlich auf gar keinen Fall verlieren und verspricht Falco die große Karriere, wenn dieser die blühende Liebesbeziehung zerstört …
Sidney Falco (Tony Curtis), ein junger, ehrgeiziger Presseagent, versucht alles, um so berühmt und mächtig zu werden wie der Journalist J. J. Hunsecker (Burt Lancaster), dessen Zeitungsrubrik Karrieren ebenso schnell starten wie zerstören kann. Doch Hunsecker lässt Sidney immer wieder abblitzen, bis er eine Chance sieht, wie ihm der Emporkömmling nützlich sein könnte: Falco soll seine Kontakte nutzen, um den jungen Musiker Steve Dallas (Martin Milner) öffentlich zu denunzieren, der mit Hunseckers Schwester Susan (Susan Harrison) liiert ist. Hunsecker will seine Schwester nämlich auf gar keinen Fall verlieren und verspricht Falco die große Karriere, wenn dieser die blühende Liebesbeziehung zerstört …